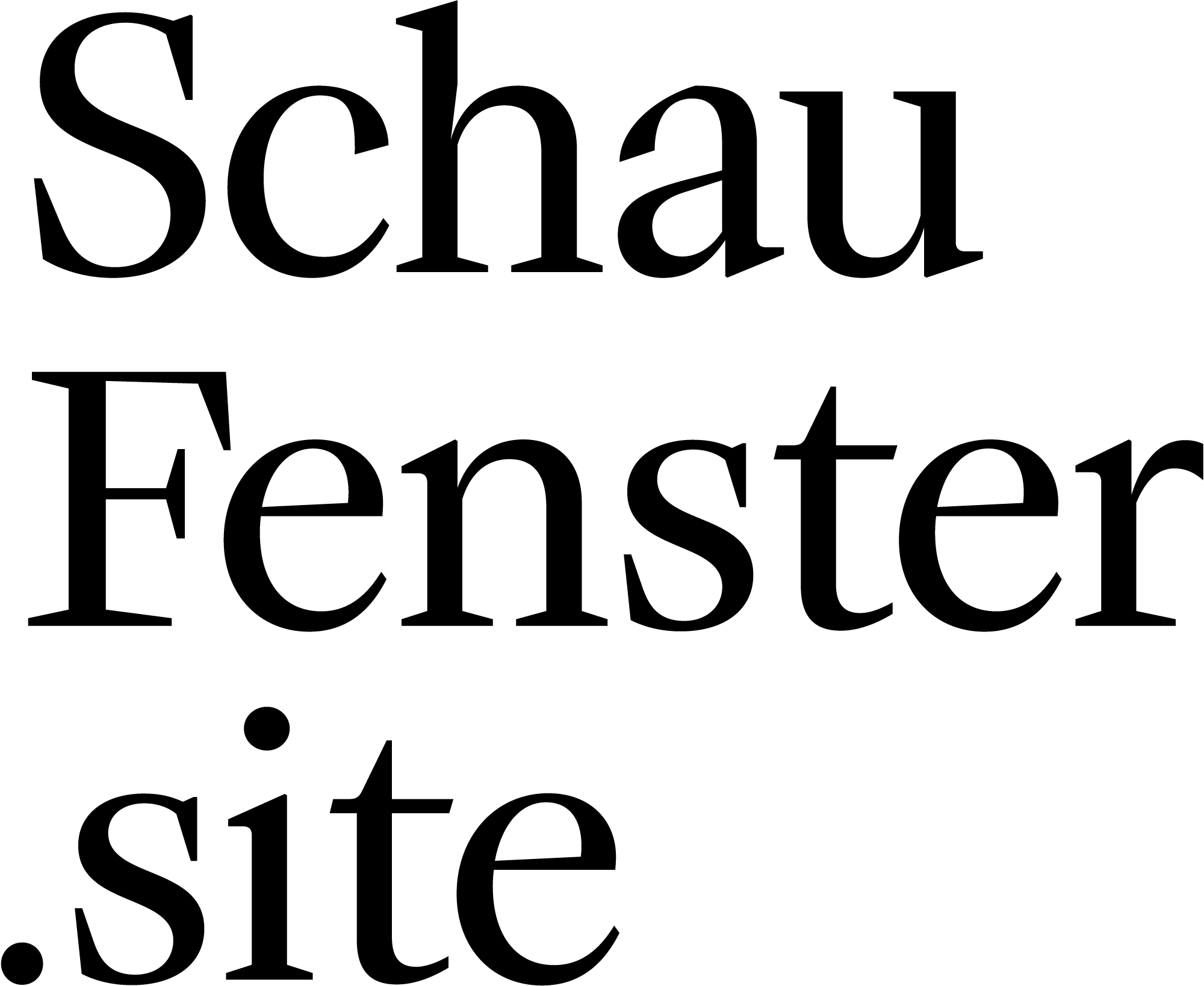SchauFenster: Entstehungsgeschichte und Konzept
Mein Name ist Brigitta Schmidt-Lauber. Ich bin Alltagskulturwissenschaftlerin und arbeite am Institut für Europäische Ethnologie der Universität Wien. Hier stelle ich den Hintergrund eines aus vielfältigen Begegnungen vor Ort gewachsenen Ausstellungs- und Sammlungsprojektes im österreichischen Weinviertel vor, das sich hinter dem Namen SchauFenster verbirgt.
Seit 2015 bin ich regelmäßig im Retzer Land und diesem zunehmend verbunden. Nicht erst die COVID-Pandemie führte mir die Möglichkeiten eines Lebens am Land vor Augen; schon zuvor hatten mich die Menschen, die Landschaft und die regelmäßige Weingartenarbeit für sich eingenommen. Seit 2020 haben mein Sohn Oskar und ich in der heutigen Waldstraße 24 in Oberretzbach einen Zweit- bzw. nunmehrigen Hauptwohnsitz. Den 2024 fertiggestellten Umbau des Hauses gestaltete der Lehmbauarchitekt Andi Breuss (https://www.andibreuss.at/), der ebenfalls in Retzbach einen Zweitwohnsitz hat.
Wie alles begann
Zum Einzug schenkten mir Nachbar:innen und Freund:innen historische Fotos des Hauses und des umliegenden Ortes. Viele Bilder zeigten ein bis 1999 in unserem Haus befindliches Gemischtwarengeschäft, das zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts zunächst von der Familie Roth und später von der Familie Blei betrieben wurde und die Nachbarschaft mit allerlei Produkten des täglichen Bedarfs versorgte. Daneben erzählten zahlreiche Anwohnende persönliche Erinnerungen und Geschichten über das frühere Geschäft. Sie verdeutlichten die soziale und alltagspraktische Bedeutung der nicht mehr vorhandenen Greißlerei für den Ort und seine Bewohner:innen.


Am Beispiel des Hauses wurde die Alltags- und Gesellschaftsgeschichte der vergangenen Jahrzehnte greifbar: Die Auflösung des lokalen „G’schäfts“ ging mit der sukzessiven Verlagerung der alltäglichen Versorgung hin zu Supermärkten in Retz oder auf Zustelldienste einher, wodurch sich auch die Begegnungsmöglichkeiten der Anwohnenden veränderten. Die Waldstraße 24 fungierte über das ansässige Gemischtwarengeschäft als sozialer Treffpunkt und Informationsbörse; nun ist es ein Wohnhaus. Kein unbekanntes Phänomen im ländlichen Raum.
In Gesprächen mit unterschiedlichen/verschiedenen Menschen vor Ort sowie in meinem akademischen und privaten Umfeld entstand die Idee, das vormals mit einer Spanplatte verhängte Fenster des Gemischtwarenladens straßenseitig zu öffnen und mit einer kleinen Ausstellungsfläche zwischen Fensterscheibe und der dahinterliegenden Holzwand wieder einen lokalen Kommunikationsraum zu schaffen: das SchauFenster. Mit dieser Idee nahm das Projekt seinen Anfang.
Entwicklung des Ausstellungskonzepts
Johannes Heuer (https://johannesheuer.com/) – ein befreundeter Künstler aus der Mitterretzbacher Nachbarschaft – war sogleich von der Idee angetan. Er hat das SchauFenster mit der Ausstellung „Stellenbosch 2020“ eingeweiht, die das erste Jahr der Pandemie adressiert und im Dezember 2020 eröffnet wurde. Es war ihm ein Anliegen, das patinierte Erscheinungsbild des Fensters mit seiner abbröckelnden Farbe weitgehend zu belassen und nur von toten Fliegen und Staub zu befreien. Eine unaufdringliche Installation sollte neugierig machen und Irritation erzeugen. Auch der ursprünglich grüne Schriftzug des Namens „Schaufenster“ über dem Fenster erfolgte auf Vorschlag von Johannes.

Das SchauFenster sollte von Beginn an kein exklusiver Treffpunkt für intellektuell-künstlerische Zweitwohnsitzer:innen sein, keine Kolonie städtischer Milieus auf dem Land verkörpern, sondern einen Raum für Austausch, Information, Reflexion und Begegnung aller Menschen vor Ort bieten.
Mit der zweiten Ausstellung „… mitten in der Waldstraße…“ im Juli 2021 erweiterte sich das Konzept in diesem Sinn: Das SchauFenster wurde zu einem Präsentations- und Dialograum für vielfältige Themen und Veränderungen in und um Retzbach. Die Ausstellung zeigte eine Fotocollage historischer Straßenaufnahmen aus verschiedenen Jahrzehnten sowie lebensgeschichtliche Erinnerungsmomente aus (Foto)Gesprächen, die ich jeweils mit den benachbarten Ehepaaren Landsteiner und Glaser führte. Wir saßen beisammen und betrachteten gemeinsam alte Fotografien. Währenddessen erläuterten die Ehepaare das Abgebildete und ergänzten Geschichten von früher und den damaligen Lebensumständen. Von Erich Landsteiner senior stammte die Idee der ersten Themenausstellung über die Waldstraße, die wir mit tatkräftiger Unterstützung umsetzten.
Neue Perspektiven auf den ländlichen Raum
Mit der dritten Ausstellung „wie weit …“ Ende August 2021 konkretisierte sich der Fokus des SchauFensters nochmals. Seither behandeln auch die künstlerischen Ausstellungen thematisch explizit die Lebensrealitäten im ländlichen Raum. Die in Wien und Mitterretzbach ansässige bildende Künstlerin Elisabeth Czihak (https://czihak.at/) zeigte in ihrer Fotoausstellung tiefe, atmosphärisch dichte Tag-/Nacht-Einblicke in die Geschichte eines Hauses vor dem Umbau und weckte bei vielen Betrachtenden Erinnerungen an eigene Umbauerfahrungen. Daran knüpfte im Oktober 2021 der Künstler Matthias Klos (https://www.m-klos.com/cms/website.php) mit einer Fotoausstellung unter dem Titel „Auf den Wegen sammelt sich die Zeit“ an. In der vierten Ausstellung im SchauFenster erkundete er aus persönlicher Perspektive das Beziehungsgeflecht zwischen der Landschaft im nördlichen Weinviertel, dem Verkehr sowie Infrastrukturen in der Region und setzte seine Eindrücke in einen historischen Kontext. Dadurch verdeutlichte er räumliche Veränderungen durch zunehmende Flächenversiegelung.
So hat das Konzept des SchauFensters seine heutige Kontur erhalten/seine heutige Form gefunden: Es bietet einen Ort, der sowohl alltags- und lebensgeschichtliche Themen als auch künstlerische Reflexionen des ländlichen Raums präsentiert und zur Diskussion stellt. In der Regel finden vier Mal jährlich wechselnde Ausstellungen an der Schnittstelle von Kunst und Alltagskultur statt.

Ein Ort des Austauschs und der Kooperation
Das SchauFenster ist ein Möglichkeitsraum zur gemeinsamen Ideenentwicklung und kooperativen Umsetzung, der zunehmend ein weitreichendes Netzwerk an beteiligten Akteur:innen in der Region und darüber hinaus einbezieht. Dem Prozesscharakter des SchauFenster-Projektes entsprechend, werden die Nutzungsformen laufend adaptiert.
Für die Ausstellung über die österreichisch-tschechische Grenze ab März 2025 etwa wurde erstmals auch der hinter dem Auslagenfenster befindliche Raum des ehemaligen Geschäftes selbst einbezogen. Zusammen mit Margot Fürtsch-Loos und Siegfried Loos vom Architekturbüro polar÷ sowie Elisabeth Czihak (Grafikerin) haben Alexander Stipsits (Dokumentarfilmer), Matthias Klos (Künstler), Johanna Resel (Kulturwissenschaftlerin) und ich ein Ausstellungskonzept entwickelt, das neben regelmäßigen Öffnungszeiten des Innenraums auch ein Begleitprogramm im Hof und im Kulturverein „ReKuRa“ (Retzbacher Kultur Raum) umfasst.
Das SchauFenster: on- und offline
Entstanden in Zeiten eingeschränkter physischer Begegnungsmöglichkeiten während der COVID-Pandemie lag es nahe, die Arbeiten im SchauFenster nicht nur einem kleinen Publikum vor Ort, sondern auch digital zur Verfügung zu stellen. So sind die (Ausstellungs-)Projekte einerseits physisch erlebbar und bieten Anlass zur Begegnung und Diskussionsstoff – etwa bei Vernissagen oder Spaziergängen –, und andererseits seit 2022 auch online dokumentiert. 2025 wurde die Website schaufenster.site neu gestaltet, um die Ausstellungen und eine wachsende Sammlung an weiterführenden Informationen in Form von Texten, Fotografien, Filmen und Projekten einem breiten, ortsunabhängigen Publikum zugänglich zu machen.
Gestalterischer Auftritt
Die Wiener Grafikerin Lena Appl (http://la-studio.at/) hat sich zur Gestaltung der Website und des SchauFenster-Auftritts intensiv auf das Vorhaben eingelassen und das visuelle Erscheinungsbild entwickelt. Das Farbkonzept basiert auf dem Wappen der Gemeinde Retzbach; die das Projekt kennzeichnenden Figuren entstanden aus den Buchstaben des Wortes „Schaufenster“. Beide Elemente finden sich auf Einladungen zur Vernissage, Plakaten und der Website wieder.
Technisch umgesetzt von Stefan Holzinger, ging die Website 2022 online. Nach intensiver Auseinandersetzung mit digitaler Vermittlung überarbeiteten Lena Appl, Fabian Scheidt, Johanna Resel und ich das Konzept des SchauFensters sowie dessen Online-Präsenz, woraus 2025 die neugestaltete Website entstand. Für mich war dies ein überaus lehrreicher Prozess über das Zusammenspiel von Grafik/Gestaltung und Inhalt/Aussage, aus dem ein hoffentlich ansprechender digitaler Auftritt des SchauFenster-Projektes entstanden ist.Auch das von Lena Appl entwickelte Logo des SchauFensters trägt zur Wiedererkennbarkeit des Projektes bei. Es findet sich inzwischen auch auf dem Fensterrahmen sowie auf einem Banner am Haus in der Waldstraße 24 in Oberretzbach.

Wissenschaft: Alltagskultur
Das SchauFenster-Projekt ist durch meine Perspektive als kunstaffine Alltagskulturwissenschaftlerin geprägt. Es knüpft an eine beruflich begründete und zur Gewohnheit gewordene Neugierde für Lebenswelten und Lebensgeschichten unterschiedlicher Menschen an. Das von mir vertretene Fach, die Europäische Ethnologie, untersucht /vermeintliche Selbstverständlichkeiten des Alltags in Geschichte und Gegenwart wie etwa Vorstellungen und Praktiken von Nachbarschaft, Geschlechterrollen oder Zeitregime, befragt aber auch ökonomische Strukturen und die Veränderung von Arbeitswelten und Wirtschaftsweisen. Im Mittelpunkt steht dabei stets die Perspektive der handelnden Akteur:innen.
Am Institut für Europäische Ethnologie der Universität Wien, an dem ich seit 2009 als Universitätsprofessorin tätig bin, entstanden zum Beispiel Studien zu Alltagsleben in Groß- und Mittelstädten,[1] zu den Lebens- und Arbeitsverhältnissen ländlicher Frauen in der Textilindustrie am Beispiel der Unterwäschefirma „Triumph International“ in Österreich, zu Protestkulturen in Österreich oder der Kulturhauptstadt Europas Bad Ischl Salzkammergut 2024, für die wir jeweils eine Online-Ausstellung erarbeitet haben.
Kennzeichnend für die ethnographische Arbeitsweise des Faches ist, dass auch das eigene Erleben Gegenstand der Reflexion und kulturwissenschaftlichen Analyse ist. So boten meine (Alltags)Erfahrungen als regelmäßige Besucherin und schließlich Anwohnerin im ländlichen Raum zugleich Anlass, meine eigenen Motive und mein Interesse am Landleben als gesellschaftlichen Trend eines bestimmten Milieus zu überdenken wie insgesamt zu den Veränderungen gesellschaftlicher Lebensverhältnisse in Stadt und Land zu forschen. Ich beschäftige mich wissenschaftlich mit der Geschichte und Gegenwart der alltäglichen Lebensgestaltung im ländlichen Raum, forschte und forsche zu Themen wie der Institution der „Sommerfrische“[2] oder zur Geschichte des Urlaubs nach 1945 in Österreich zur Praxis der (mehrfachen) Ortsbezüge von Menschen (Multilokalität, Mobilität).
Transformationen des Alltagslebens: Die Suche nach dem „guten Leben“
Besonders interessieren mich die aktuell zu beobachtenden Veränderungen des Alltagslebens in Stadt und Land sowie die darin erkennbaren Transformationen gesellschaftlicher Werte, die vielfältiger werdenden Lebensmodelle und sozialpolitischen Herausforderungen in unserer Gesellschaft. Gesellschaftliche Veränderungen begegnen uns in verschiedensten Zusammenhängen: so auch in einem zunehmenden kritischen Bewusstsein für Konsumgewohnheiten oder in den Auswirkungen des Klimawandels auf alltägliches Verhalten. All dies weist auf eine gesellschaftliche Umorientierung auf der Suche nach einem „guten Leben“ hin.
Eine entscheidende Rolle kommt dabei auch der Frage nach dem passenden Wohn- und Lebensort zu. In Wissenschaft und Gesellschaft ist diesbezüglich ein auffällig wachsendes Interesse am ländlichen Raum zu beobachten, das sich nicht zuletzt im SchauFenster-Projekt widerspiegelt. Ich betrachte ländliche oder städtische Räume nicht isoliert, sondern relational und verknüpft, denn erst in ihrer Wechselbeziehung lassen sich Raumkategorien zueinander aufschlüsseln.
Die Europäische Ethnologie als Disziplin, die ich vertrete und die inzwischen häufig unter dem Namen „Empirische Kulturwissenschaft“ auftritt, erkundet frühere und gegenwärtige Alltagswelten anhand historischer Quellen sowie mittels ethnographischer Verfahren. Erkenntnisgewinnung erfolgt unter anderem über teilnehmende Beobachtung bzw. das Mit(er)leben sowie durch Gespräche und Interviews. Im Mittelpunkt des Interesses stehen Menschen, deren Leben, Ansichten und Umwelten es zu verstehen gilt. Lokalgeschichte wird dabei stets mit Gesellschaftsgeschichte verknüpft und als Ausdruck gesellschaftlicher Verhältnisse verstanden. So spiegeln auch die Ausstellungen im SchauFenster als konkrete lokale Fallbeispiele übergeordnete gesellschaftliche Strömungen und Entwicklungen wider.
Die Vergangenheit hat gezeigt, dass Ethnograph:innen Gefahr laufen, ,über‘ andere Menschen zu schreiben und damit Macht auszuüben. Seit geraumer Zeit werden demgegenüber neue partizipative Arbeits- und Darstellungsformen entwickelt, in denen die Forschungspartner:innen sichtbar werden und eingebunden sind. Dies spiegelt sich auch im SchauFenster-Projekt.
Ziel: Kulturelle Teilhabe und gesellschaftlicher Dialog
Vor diesem Hintergrund verfolgt das SchauFenster-Projekt das Ziel, ein innovatives Format für kulturelle Teilhabe im ländlichen Raum zu schaffen. Auch für die ethnographische Forschung und Repräsentation bieten sich Impulse durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Unterschiedliche Personen generieren und teilen Wissen und Sichtweisen zu Themen des Landlebens. Dazu gehören die Veränderungen der sozialen Verhältnisse und Bewohner:innengruppen, des Wirtschaftens und Überlebens am Land oder des Alltags an der österreichisch-tschechischen Grenze.
Im Fokus steht die Vielfalt der Menschen, Lebenssituationen und -konzepte vor Ort – seien es lokale Weinbauern und -bäuerinnen, Pensionist:innen, Pendler:innen, Zugezogene oder Zweitwohnsitzer:innen.
Kooperation: Beteiligung erwünscht
Die Adressat:innen des Projekts sind sowohl Menschen aus der Region als auch allgemein Interessierte am Thema „Leben am Land“ oder an Fragen des gesellschaftlichen Wandels. Das SchauFenster lebt von Anregungen aus einem vielschichtigen Umfeld und verdankt seine Existenz einer breiten Unterstützung vieler engagierter Akteur:innen. 2024 förderte auch das Amt für Kunst und Kultur des Landes Niederösterreich das SchauFenster, zudem ist es in der regionalen Museumsbroschüre gelistet. All den beteiligten Einrichtungen und Personen, den Nachbar:innen und Freund:innen, den Künstler:innen und Kolleg:innen, den Förder:innen und Kooperationspartner:innen möchte ich herzlich für ihr Engagement, ihr Mitdenken und ihr wertvolles Feedback zu diesem gemeinschaftlichen Vorhaben danken. Ich freue mich über weitere Anregungen, Beiträge, Ausstellungsvorschläge sowie Interesse an einer anderen Form der Beteiligung am SchauFenster. Sie sind herzlich zur Mitwirkung eingeladen!
[1] Eckert, Anna/Schmidt-Lauber, Brigitta/Wolfmayr, Georg: Aushandlungen städtischer Größe: Mittelstadt leben, erzählen, vermarkten (= Ethnographie des Alltags, 3). Wien 2020.
[2] Schmidt-Lauber, Brigitta (Hg.): Sommer_frische. Bilder. Orte. Praktiken (= Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Ethnologie der Universität Wien, 37). Wien 2014.